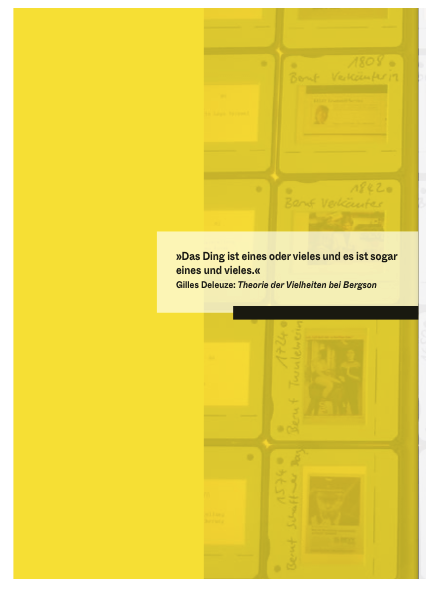Text über die Flut der Dinge, intime Dinge, Weltdinge, die Infrasichtbarkeit der Alltagsdinge, die Verstocktheit der Dinge, Listen als Medium für Dinge und die Tatsache, dass die Beziehung zu unseren Sachen vor allem eines nicht ist: sachlich.
Prolog: Es ist geschafft. Die von Menschen hergestellten Dinge wiegen seit 2020 erstmals in der Geschichte des Planteten mehr als die gesamte Biomasse der Erde. Jede Woche wird „anthropogene Masse“ produziert, die in etwa dem Körpergewicht aller Menschen auf der Erde entspricht. Gigatonnen natürlicher Ressourcen werden extrahiert und stabilisieren sich als Artefakte von meist zeitlich begrenzter Dauer. Von jedem eins: ein Ding der Unmöglichkeit. Der Geist der Wunderkammer hat die meisten Archive der Gegenwart verlassen. Entsammlung. Es herrscht Kassation.
Die globalen Zusammenhänge der Dinge – die Produktionsbedingungen und die Entsorgungsfragen – werden nach und nach offenkundiger und überwältigender. In ihren intimsten Relationen aber drängen sich die Dinge in unser Bewusstsein als Gefährten, als Speicher von Erinnerungen und Emotionen. Dinge sind dabei durchaus als Teile des Selbst zu betrachten. „Diese Schlangenlederjacke ist ein Symbol meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit,“ ruft Sailor im Film „Wild at Heart“.[1] Der Psychoanalytiker Willliam Ronald Fairbarn schreibt: „Das Ich ist undenkbar, wenn es nicht mit Objekten verbunden ist. Es wächst durch Objektrelationen, sowohl durch reale als auch interne, wie die Pflanze durch den Kontakt mit dem Boden, mit Wasser und mit Sonnenlicht.“[2] Dinge sind der Nährboden unseres alltäglichen Lebens und sie sind ebenfalls „ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil unserer Beziehungen.“[3] Das Verhältnis zu den Dingen definiert das Verhältnis zur Welt. Die Beziehung zur Welt ist in unseren Dingen.
Der Archäologe Ian Hodder hat eine Theorie der menschlichen Evolution und Geschichte entworfen, die auf einer ständig zunehmenden gegenseitigen Verschränkung von Menschen und Dingen basiert: Lehm führt zu Topf, der Topf hält die Milch von gestern, mit Topf kann man sich von der Kuh entfernen, ohne Topf kein Joghurt und Käse, neue Nahrung führt zu kultureller und genetischer Evolution, mit dem Topf entwickeln sich immer neue Techniken und Innovationen, Töpfe bekommen Deckel, werden aufgestellt, führen zu Schränken, Schöpfkellen, Kühlkammern, zu immer neuen Dingen, neuen Ensembles. Töpfe werden ausgestellt, bemalt, beeinflussen gesellschaftliche Stellung, dekorieren Häuser, werden zu Tupperdosen. Diese endlosen Verflechtungen von Mensch/Ding und Ding/Ding dehnen sich aus im Lauf der Zeit und können nicht zurückgedreht werden. Die Erfindung des Rads hatte Konsequenzen, weltumspannende Konsequenzen, für Menschen und Dinge. „Die kleinste reale Einheit ist nicht das Wort, nicht die Idee oder der Begriff und nicht der Signifikant – es ist das Gefüge.“[4]
Das Existieren im Gefüge mit den Dingen, hält uns in der Welt. Heidegger nennt es Wohnen, Wohnen ist der Aufenthalt bei den Dingen. „Das Ding dingt Welt.“ Der Aufenthalt in diesem Gefüge hat Folgen: ein Leben im Wohnraum, dort wo „Subjektivität das Ergebnis der Ordnung der Dinge“[5] ist. Die Gefüge aus Dingen, die uns tagtäglich Gesellschaft leisten, vermitteln Stabilität und Identität. In Hannah Arendts Augen ist es die Aufgabe der „Weltdinge“, „menschliches Leben zu stabilisieren, und ihre ‚Objektivität’ liegt darin, dass sie der Veränderung des natürlichen Lebens (…) eine menschliche Selbigkeit darbieten, eine Identität, die sich daraus herleitet, dass der gleiche Stuhl und der gleiche Tisch den jeden Tag veränderten Menschen mit gleichbleibender Vertrautheit entgegenstehen.“ Dinge bilden eine stille Gemeinschaft[6], von „Gegen-ständen“ im Heideggerschen Sinn. Sie stehen einem sich beständig verändernden Subjekt in einer sich beständig verändernden Welt entgegen. Dinge geben dem Ich, dem Subjekt der Selbsterfahrung, das nicht aufhört sich zu verändern, eine kleine Pause. „Die materiellen Gegenstände, mit denen wir täglich in Berührung kommen, (…) kommen einer schweigsamen und unbeweglichen, an unserer Unrast und unseren Stimmungswechseln unbeteiligten Gesellschaft gleich, die uns den Eindruck von Ruhe und Ordnung gibt,“ schreibt Maurice Halbwachs, den man zweifellos eher zitieren sollte als Heidegger, dessen schwarze Hefte in die Kategorie grausamer Dinge gehören, aber das führt hier zu weit.
Die Stabilität der Dinge ist zugleich trügerisch. Das Wohnen funktioniert nach der alten Dialektik des Flusses: „Unaufhörlich strömt der Fluss dahin, gleichwohl ist sein Wasser nie dasselbe. Schaumblasen tanzen an seichten Stellen, vergehen und bilden sich wieder – von großer Dauer sind sie allemal nicht. Gleichermaßen verhält es sich mit den Menschen und ihren Behausungen.“[7], stellt der japanische Schriftsteller Kamo no Chomei im 12. Jahrhundert fest. Dennoch erwecken die Dinge den Eindruck der Beharrlichkeit, der Unbeweglichkeit und Ruhe. Und es ist dieser Eindruck der Solidität, der die Dinge gleichzeitig fast zum Verschwinden bringt. Alles, was die jeweilige Umwelt, Lebenswelt, Dingwelt ausmacht, ereignet sich im Alltag überwiegend unterhalb der Sichtbarkeitsschwelle im Bereich der Unauffäligkeit. In der Dingumwelt regiert die Infrasichtbarkeit. Man denke an all die Dinge in einem Schwebezustand, die eventuell schon durch neue ersetzt wurden und aus ihrer Dingfamilie herausgerissen wurden. Die „vorübergehend“ im Haushalt hinter Türen wohnen und in Ecken, „Für alle Fälle“. All die Objekte, deren Kraft auf ein großes Ganzes zu verweisen verblasst, die nicht mehr zu ihrem Objektensemble gehören, die ihre lokale Bedeutung verlieren. Die ab und an ein „Ich sollte wirklich mal…“ auslösen. Sie sehen diese Dinge nach kurzer Zeit nicht mehr, aber Sie fallen auch nicht darüber. Das Mittel der Infrasichtbarkeit ist Transparenz.
Die Dinge verlieren ihre Infrasichtbarkeit, ihr Dasein in Unauffälligkeit, erst in Momenten des Befragens, des Bewegens oder in Momenten des Verschwindens, besser im Moment des „fast verschwunden Seins“, in dem sie eine historische Funktion einnehmen. Häufig ist es erst im Nachgang zu verstehen, wie sehr bestimmte Dinge für eine bestimmte Epoche standen. Das Alltäglichste trägt das Gefüge der Zeit. Die überlebenden, vor dem Verschwinden geretteten Dinge gewinnen ihren Wert durch ihre durchlebte Zeit. Vor dieser Folie der Infrasichtbarkeit ist die Arbeit von Karsten Bott an seinem “Archiv für Gegenwartsgeschichte“ zu denken.
Eingang in dieses obsessive Archiv finden: „Werkzeug, Verpackungen, Klodeckel, Brillenbügel, Zahnbürsten, Zeitschriften, Bimssteine, Eierwärmer, Schneebesen, Radio, Joghurtbecher usw. Sie können alt, neu, abgenutzt, defekt, intakt, beschädigt oder voller Gebrauchsspuren sein. (…) Der Künstler entreißt die Gegenstände dem Kreislauf von Produktion, Erwerb, Gebrauch, Verschrottung und fügt sie in eine fortlaufende Enzyklopädie, in der die Dinge einen Wert um ihrer selbst Willen erlangen.“[8]
Der Künstler schafft ein „Ensemble der Dinge, in denen das kollektive Leben seinen Sitz hat“[9]. Ein heroischer Akt.
Wie über, mit, von diesen Dingen sprechen?
Alle materiellen Objekte teilen die Eigenschaften von Mehrdeutigkeit und interpretativer Offenheit bei gleichzeitiger „Verstocktheit des Dingseins“[10] Dinge bewegen sich jenseits der Sprache, aber sie sind nicht stumm. Sie können fremd sein, unzugänglich, angewiesen auf Interpretation, Kontextualisierung und Translation – und doch, „die Idee, dass die Dinge sich äußern ist da“ , so Karsten Bott.
Ein Mittel und Medium, um den Dingen nahezukommen, sie zum Sprechen zu bringen ist die Liste. Sie bettet ein. Sie ist per se anarchisch und hierarchiefrei. Sie ist bestimmt von den Eigenschaften der Mannigfaltigkeit: “Eine Mannigfaltigkeit ist nichts, was in den Gliedern steckte, einerlei wie viele es sind, in deren Menge oder in der Totalität. Sie steckt allein im UND, das von den Elementen, deren Mengen und selbst von den Relationen verschieden ist, so verschieden, dass es sogar zwischen zwei Gliedern allein sich abspielen kann und gleichwohl die Dualismen durcheinanderbringt. Das UND ist von fundamentaler Kargheit, Armut, Askese.“[11] In der Liste herrscht nicht das Gesetz der Reihe, sondern die Potenz des UND.
„Von jedem eins“ nutzt die Listen der Listen. Verweigert sich der Serialität und verschreibt sich der Synchronizität. Erzeugt Listenresonanz. Lässt Listen interagieren: Listen aus Karsten Botts Arbeit – Dokumentationen, Pläne, Systematiken, Verschlagwortungslisten, Karteikarten, Katalogtexte – schwingen mit externen rätselhaften Listen. Durch den Zugriff von Oliver Augst und Marcel Daemgen werden diese Listen in ein anderes Medium, das der musikalischen Performance, übertragen. Sie schichten Klänge, bestehen auf Gleichzeitigkeit, manipulieren die Zeitlichkeit, interagieren, spielen, sampeln, retten, verwerfen, bergen, verfremden, zersingen.
Das Gewahr werden der Dingumwelt, der Vielstimmigkeit der Objekte, ihrer vielfältigen Verbindungen zur Zeit und ihrer Beziehungen, bedürfen das Gewinnen einer neuen Mannigfaltigkeit. „Von jedem eins“ ist die Übersetzung dieser Perspektive der Vielheit und der Gleichzeitigkeit in ein musikalisches Format.
Dramaturgisch folgt die Performance dabei dem Prinzip der Katachresis, der Juxtaposition wie Michael Shanks sie für die Archäologie propagiert: Dinge zusammenfügen, die nicht zusammengehören. Sehen was passiert. Ansporn mit diesen Reibungen und Ungereimtheiten umzugehen. Gegenüberstellen, Misstöne erzeugen, das Vertraute fremd werden lassen, verlagern, verfremden, verschieben. Kurz: ein Echo bilden.
Epilog: Der Geist der Wunderkammer hat die meisten Archive der Gegenwart verlassen. Er ist ausgezogen in die Welt. Die Wunderkammer ist zu klein geworden, den Kosmos zu repräsentieren. Die Dinge selbst schaffen mannigfaltige Tatsachen, überall. Von jedem eins.
[1] Nicolas Cage als Sailor in Wild at Heart, deutscher Titel: Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula, R.: David Lynch, P.: Propaganda Films und Polygram, 1990.
[2] Willliam Ronald Fairbarn, zitiert nach Karin Knorr Cetina: Sozialität mit Objekten, in: Werner Rammert (Hg.): Technik und Sozialtheorie, 83-120, Frankfurt 1998, 102.
[3] Daniel Miller: Der Trost der Dinge, Frankfurt 2011, 207.
[4] Gille Deleuze und Claire Parnet: Dialoge, Berlin 2019, 77.
[5] Gisela Ecker
[6] Die Idee, diese unbewegliche Gesellschaft der Dinge könnte aufhören zu schlummern, bildet den vollkommenen Nährboden jeder animistischen Fantasie. Alfred Polgar notiert: „Ich liebe die Einsamkeit, aber die Einsamkeit meines Zimmers liebe ich nicht. Weil ich ein tiefes Misstrauen gegen die Dinge in ihm, gegen Wände, Möbel, Bilder habe und mich ihnen ausgeliefert fühle. Es sind viele gegen einen. Ich spüre, dass sie mich anstarren und ahne Zeichen der Verständigung zwischen ihnen und pfeife sorglos, um ihnen zu zeigen, dass ich mich gar nicht fürchte. Niemals öffne ich nachts, heimkehrend die Wohnungstür, ohne ein wenig absichtlichen Lärm zu machen. Ich will nicht überraschen, besser: Ich will nicht überrascht werden. Wurde meine Abwesenheit von den Dingen benützt, um Unfug zu treiben, so sollen sie, rechtzeitig von meiner Nähe unterrichtet, noch Zeit haben, wieder in ihre gewohnte dreidimensionale Ordnung zurückzuschlüpfen.“
Alfred Polgar: Kreislauf. Kleine Schriften. Band 2, Hamburg 2002, 17.
[7] Kamo no Chomei: Hojoki. Aufzeichnungen aus meiner Hütte, Frankfurt 1997, 7.
[8] Natalie de Ligt, Vorschau: Karsten Bott. Von Jedem Eins ab 17.2.2011, Kunsthalle Mainz, 2011.
[9] Marcel Mauss: Die Gabe, Frankfurt 1990, 199.
[10] Lorraine Daston: Introduction, in: Lorraine Daston (Hrsg.), Things that Talk. Object Lessons from Art and Science, New York 2004.
[11] Gille Deleuze und Claire Parnet: Dialoge, Berlin 2019, 84.